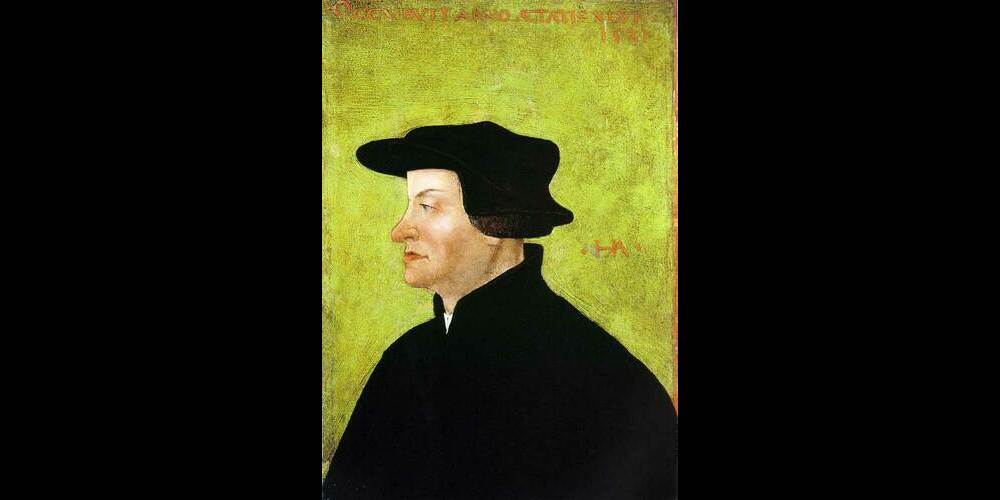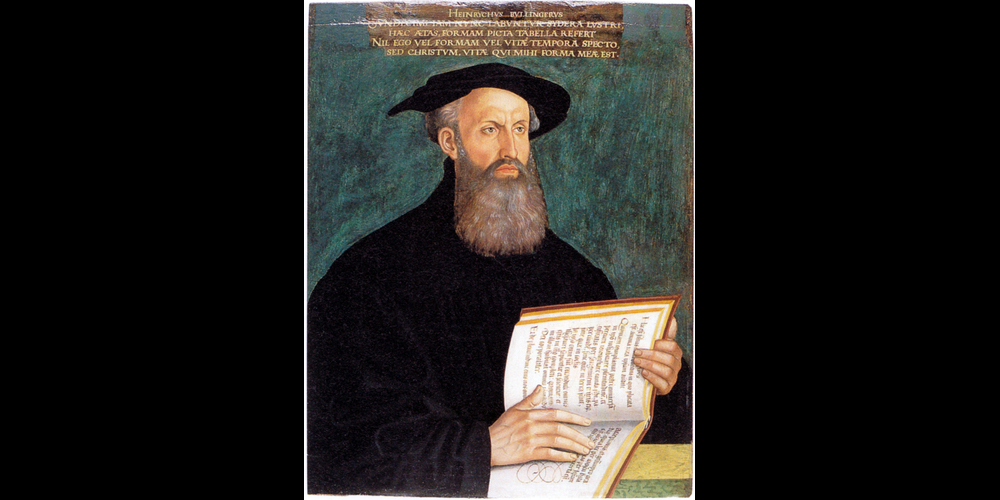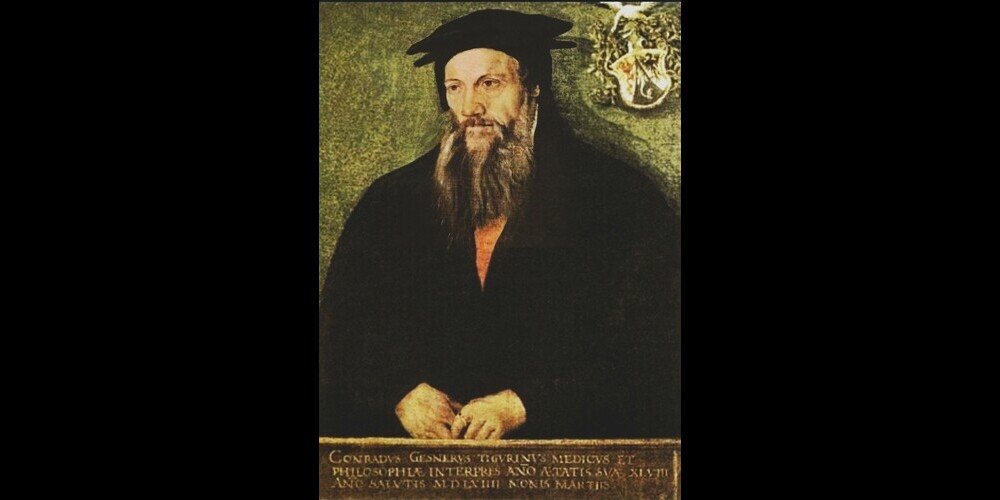Dominique Rais
Der Körper mit schwarzen Flecken übersäht, eitrige Beulen und Blasen an Hals, Achseln und Leisten: Die Pest hat vom Spätmittelalter, Mitte des 14. Jahrhunderts, bis in die frühe Neuzeit, Mitte des 17. Jahrhunderts, in der Stadt Zürich sowie auf dem Land über eine Viertelmillion Menschen dahingerafft. Doch die Dunkelziffer der Zürcher Pesttoten in dem besagten Zeitraum dürfte weit höher sein, wie aus der Auflistung «Ansteckende Krankheiten in Zürich», die in der Ausgabe der «Zürcher Statistischen Nachrichten» von 1937 erschienen ist, hervorgeht.
Eine der ersten historisch belegten Pestwellen traf die Stadt Zürich 1349 – vor 675 Jahren. Die genaue Zahl der Todesopfer ist nicht bekannt. Allerdings soll der Schwarze Tod damals schweizweit über 180 000 Menschenleben gekostet haben. Im 15. und 16. Jahrhundert häuften sich die Pestausbrüche – dabei blieb auch Zürich nicht verschont. Gemäss Aufzeichnungen starben 1434 – vor 590 Jahren –, als die Pestilenz abermals die Limmatstadt heimsuchte, in der Stadt 3000 und auf dem Land weitere 25 000 Menschen.
In den Fängen der Seuche
Wer sich erst einmal mit der Pest infiziert hatte, für den gab es damals kaum Chancen, die Seuche zu überleben. «Sie ist in der Tat ein über alle Massengiftiges, hitziges, ansteckendes und tödliches Fieber. Ja, das giftigste von allen Fiebern, davon die Menschen plötzlich überfallen werden und in wenigen Stunden oder Tagen mit oder ohne Flecken, Blattern, Beulen oder schwarzem Brand-Trüsen meistenteils dahinsterben», beschreibt der Zürcher Mediziner und Anatom Johann von Muralt (1645–1733) in seiner 1721 veröffentlichten Schrift «Kurtze und grundliche Beschreibung der ansteckenden Seuche der Pest» den Schwarzen Tod.
In seiner Funktion als Stadtarzt war er ab 1688 unter anderem mit der Seuchenbekämpfung in der Limmatstadt betraut. Aufgrund der Vielzahl der Pestopfer wurden in der Stadt Massengräber ausgehoben, um die Toten rasch beisetzen zu können.